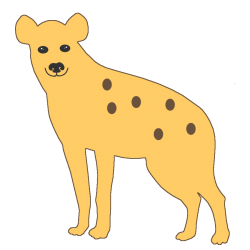„Provozieren“ ist derzeit bei uns ein großes Thema. Die eine große Tüpfelhyäne kann manchmal sagen, was sie will. Bei der kleinen Tüpfelhyäne kommt alles als Provokation an. Sie sagt dann immer: „Du provozierst mich!!!“ Die große antwortet dann: „Nein, du fühlst dich provoziert.“
Provozieren gehört zum Alltag. Leben an sich ist eine Provokation.
Diese kurze Unterhaltung zeigt auch, dass Provokation entweder aktiv vom Sender ausgehen oder lediglich vom Empfänger gefühlt werden kann, ohne dass der Sender provozieren wollte.
Provozieren kann mit einer Prise Humor erfolgen, aber auch mit starker Aggressivität und eben auch mit den Abstufungen dazwischen. Lange Zeit war für die kleine Tüpfelhyäne auch gewolltes Provozieren mit Wohlwollen und Humor ein riesiges rotes Tuch.
Schweigen kann ebenfalls Provokation sein. Die eine Tüpfelhyäne fühlt sich zum Beispiel dadurch provoziert, dass ihr Chef sie bezüglich einer Gehaltserhöhung ein halbes Jahr lang hinhält, nachdem sie bereits ein halbes Jahr mehr Verantwortung übernimmt.
Sich zu verändern kann bereits eine Provokation sein. Manch ein Leser wird schon zu hören bekommen: „Du hast dich so verändert. Am Anfang unserer Beziehung warst du ganz anders.“
Ich habe einen Vorwurf gehört. Ich habe die andere Person damit provoziert, dass ich mich verändert habe. Menschen sind Gewohnheitstiere und mögen Veränderung nur in einem gewissen Maße.
Menschen provozieren oft, wenn sie nicht authentisch und nicht selbstbewusst sind. Provokation sollte auch nicht angst-, scham- oder schuldbehaftet sein.
Provokation kann man als Gegner oder als Partner aufnehmen. Möchte man sie als Partner aufnehmen, ist wichtig, dass man in Kontakt und gleichzeitig gelassen bleibt. Die meisten Menschen brechen den Kontakt dann ab oder weichen aus. Außerdem kann man immer selber entscheiden, wovon man sich provoziert fühlt und dass man eine Provokation von sich abperlen lassen will.
Man kann eine Provokation auflösen oder sie benutzen, um zu polarisieren. Die Geschichte einer Provokation wird immer von beiden Teilnehmern geschrieben.
Provozieren kann sowohl zerstören als auch aufbauen. Außerdem kann man beim Provozieren auch freundlich sein. Die eine Tüpfelhyäne hatte einen Lateinlehrer, der sie bei der Rückgabe schlechter Arbeiten äußerst freundlich provoziert hat. Die Tüpfelhyäne dazu: „Dem konnte ich gar nicht böse sein!“
Wenn ich mit Provokation etwas bewegen will, muss ich schauen, wie intensiv oder subtil ich das mache. Denn wenn ich zu offen und zu direkt provoziere, macht die andere Person möglicherweise sofort dicht. Wenn ich es zu subtil mache, kommt es nicht an und erzielt nicht das gewünschte Ergebnis.
Manchmal lassen wir uns davon abhalten, etwas auszudrücken, nur weil der andere sich provoziert fühlen könnte.
Unsere Ziele:
Provokation bewusster wahrnehmen, also auch wenn wir selber provozieren.
Wenn wir im Begriff sind, negativ zu provozieren, die Provokation auch mal abbrechen.
Provokationen anderer nicht annehmen oder sie bewusst nicht als solche verstehen.
Andere darauf hinweisen, dass man sich provoziert fühlt.
Wenn wir provozieren, dann bewusst und positiv.